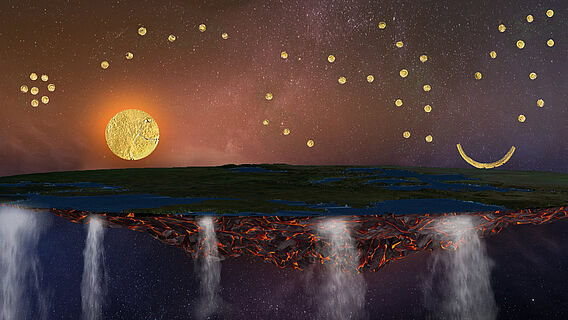Archäologische Fundstücke, eine Münzsammlung, völkerkundliche Exponate, Objekte zur Geschichte Hannovers, eine naturkundliche Abteilung und Kunst: Die Sammlung des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover ist gigantisch. Davon zu sehen bekommen die Besucherinnen und Besucher in der Regel nur einen Bruchteil. Kein Wunder: So enthält allein die archäologische Sammlung etwa zwei Millionen Objekte, wovon nur ein sehr kleiner Teil ausgestellt werden kann.
Da wäre es doch eine verlockende Idee, wenn interessierte Gäste zumindest digital die Möglichkeit bekommen, sich im Depot umzusehen und über Objekte ihrer Wahl zu informieren. Diese Möglichkeit will das Museum in gut zwei Jahren mithilfe einer spektakulären Technik bieten: einer immersiven 360°-Projektionsumgebung, die Fotos, Filme, Objekte, Karten, Webseiten und viele weitere Formen von Datenvisualisierungen präsentieren kann. Bis zu 25 Personen sollen dort gleichzeitig ihre digitale Umgebung interaktiv erkunden können. Dass sie dort das geboten bekommen, was sie suchen: Darum kümmert sich die Museologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in einem neuen Forschungsprojekt.
Was Besucher erwarten
»Publikumsforschung sowie Evaluierung und Optimierung des Audience Engagement im Datarama«: So lautet der Auftrag an die Würzburger Museologie wissenschaftlich formuliert. Datarama: So der Produktname der Projektionsumgebung – einer Entwicklung des Göttinger Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften.
»Wir klären mit den Museumsleuten, welche Inhalte sie im Datarama präsentieren wollen, und testen diese an einem Publikum«, schildert Guido Fackler, Professor für Museologie an der JMU, die Vorgehensweise konkreter. Auf diese Weise könnten die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schnell erkennen, mit welchen Erwartungen sich die Interessierten in den Projektionsraum begeben, und Angebote identifizieren, die gut funktionieren, und solche, die eher wenig Anklang finden.
Spielerische Elemente gehören dazu
Die Vorstellung der Museumsverantwortlichen, im Datarama Bilder von Objekten zu präsentieren und den Betrachtern die Möglichkeit zu einer vertiefenden Recherche zu bieten, begrüßt Fackler prinzipiell. Die Umsetzung hält er für verbesserungsfähig: »Objekte zu zeigen und begleitende Informationen in Textform dazu zu liefern: Das ist sehr verkopft und funktioniert in der Regel nicht, selbst dann nicht, wenn man Videos und Audiosequenzen einbindet«, sagt er. Facklers Vorschlag: Das Museum muss spielerische Elemente in die Präsentation integrieren.
Die wesentlichen Fragen, die das Forschungsprojekt beantworten soll, lauten für den Museologen deshalb: »Wie machen wir das Angebot spannend? Wie kann man die Geschichte hinter den Objekten möglichst fesselnd erzählen?« Um das herauszufinden, greifen Fackler und seine Doktorandin und Projektmitarbeiterin Anna-Sophie Karl unter anderem auf Ergebnisse aus der Spieleforschung zurück und versuchen, diese im Projektkontext zu testen.
Ohne Motivation geht es nicht
Was sie in erster Linie interessiert, ist die Frage, mit welchen Mitteln sich bei den Besucherinnen und Besuchern die Motivation stärken lässt, an dieser Art eines »Spiels« teilzunehmen. Gruppenerlebnisse können solch ein Element sein – wenn beispielsweise zwei Gruppen gegeneinander antreten und möglichst schnell eine Reihe von Aufgaben lösen sollen. Bestätigung könnte ein weiteres Motiv sein – also die Freude über den Erfolg, wenn man sein Wissen und seine Kompetenz einbringen konnte. Das alles natürlich innerhalb gewisser Grenzen: »Es soll nicht so sein, dass am Ende Verlierer feststehen und sich unglücklich fühlen«, sagt Fackler.
In den kommenden Monaten wollen Fackler und Karl Szenarien entwickeln, diese mit Besucherinnen und Besuchern testen und anschließend – wenn nötig – verfeinern. Auch Studierende wollen sie an diesem Prozess beteiligen, schließlich soll das Projekt »auch einen Mehrwert für die Lehre haben«, wie Fackler sagt. Zeit im Überfluss haben sie dafür nicht: »In zweieinhalb Jahren soll Datarama an den Start gehen. Wir müssen also bald etwas auf die Beine stellen, was dann läuft«, so der Museologe.
Forschung im Neuland
Was die Arbeit möglicherweise erschwert, ist die Tatsache, dass es sich bei Datarama um eine technische Neuentwicklung handelt, die sich bisher noch nicht im öffentlichen Einsatz bewährt hat. Auf Erfahrungen von anderen Einrichtungen können Fackler und Karl deshalb nicht zurückgreifen, das Projekt ist für sie »reines Neuland«. »Erfahrungen sammeln und mit dem Machen schlauer werden«, sei somit wesentlicher Bestandteil des Forschungsprozesses.
Ein Ziel steht für Guido Fackler allerdings jetzt schon fest: Am Ende soll kein digitales Tool stehen, das in erster Linie cool ist. »Es muss auch inhaltlich mit dem Museum und seinen Sammlungen, Ausstellungen und Angeboten verknüpft sein«, so der Museologe. Im Idealfall lassen sich also Besucherinnen und Besucher im Datarama von der digitalen Präsentation faszinieren. Am Ende steht dann aber bei ihnen der Wunsch, das Objekt, mit dem sie sich beschäftigt haben, jetzt auch einmal im Original zu sehen.
Das Datarama
Das Datarama setzt sich aus zwei Teilen zusammen: einer Hard- und einer Software-Komponente. Die Hardware besteht aus einer umlaufenden Projektionsfläche, die knapp drei Meter hoch ist und einen Radius von sechs Metern hat, sowie einem Zylinder mit sechs Videoprojektoren und einem Server-PC. Ein gut ein Meter hohes Bedienfeld in der Mitte dieser Rotunde ermöglicht über eine berührungsempfindliche Oberfläche und Gestensteuerung die Interaktion mit den dargestellten Daten.
Die zweite Komponente ist eine spezielle Software, die aus mehreren Webanwendungen besteht, die über eine ereignisgesteuerte Architektur miteinander verbunden sind. Sie liefert unter anderem immersive Panorama-Ansichten von Fotos und Videos sowie simulierte Umgebungen und 3D-Objekte. Im Angebot sind verschiedene Interaktionsmodi einschließlich einer intuitiven, gestenbasierten Benutzeroberfläche zum Auswählen, Kommentieren und Filtern von Daten. Darüber hinaus lässt sich die Software auf unterschiedlichen Anzeigegeräten wie Computermonitoren und -tabletts, digitalen Projektoren und neuen Formaten wie beispielsweise VR-Headsets wie Oculus Rift und Google Cardboard verwenden.