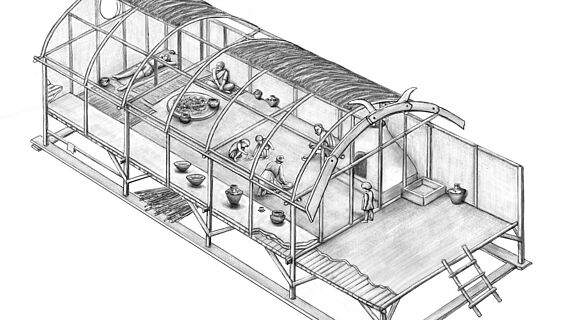Wenn Knochen von Lebewesen in den Boden gelangen, werden sie normalerweise zersetzt. Für Paläontologen ist es ein Glücksfall, dass es in der langen Erdgeschichte manchmal anders kam: In einem komplizierten Prozess wurden aus Knochen von Dinosauriern oder Riesenhirschen ausnahmsweise dauerhaft konservierte Fossilien. Der Paläontologe Prof. Hans-Ulrich Pfretzschner vom Institut und Museum für Geologie und Paläontologie der Universität Tübingen untersucht, welche Faktoren bei der Fossilisation eine Rolle spielen. In seiner Arbeitsgruppe werden fossile Knochen außerdem den vor Millionen von Jahren ausgestorbenen Arten zugeordnet und bis auf mikroskopisch kleine Strukturen untersucht. Diese können Anhaltspunkte für das Leben des individuellen Tieres und seine Umwelt bieten.
"Knochen müssen mit ihrem Bau ganz unterschiedliche Bedingungen erfüllen", erklärt Pfretzschner, der sein Arbeitszimmer mit zahlreichen Untersuchungsobjekten, Schädeln und Knochen, teilt. Besonders schwere Knochen fänden sich etwa bei den vor Millionen von Jahren im Meer lebenden Nothosauriern und den heutigen Seekühen, die die Knochen als Gewichte beim Tauchen einsetzen. Dagegen seien die Knochen von Wirbeltieren, die schnell beschleunigen müssen, wie den ausgestorbenen wasserbewohnenden Ichthyosauriern oder heutigen Delfinen, leicht gebaut. Als Beispiel, wie Paläontologen aus Knochen Informationen gewinnen können, zieht Pfretzschner Teile eines fossilen Geweihes von einem Riesenhirsch hervor. "Heute lebende Rothirsche setzen ihre Geweihe bei Revierkämpfen ein. Die Geweihe sind aus elastischen, weichen Knochen aufgebaut. Bei einem Stoß wird die Energie schnell verteilt, sodass der Knochen nicht bricht", erklärt Pfretzschner. Ihn interessiert, ob die eiszeitlichen Riesenhirsche mit ihren ausladenden, schweren, bis zu drei Meter großen Geweihen ebenfalls kämpften. Doch zunächst müssen sich die Wissenschaftler auf den heutigen Rothirsch konzentrieren. "Gut die Hälfte unserer Arbeit besteht in der Untersuchung der Knochen heute lebender Tiere. Denn bei ihnen kennen wir die Lebensgewohnheiten und die Umwelt", erklärt der Paläontologe.
In seiner Arbeitsgruppe wird auch erforscht, wie das Kämpfen der Männchen überhaupt entstanden ist. Hierzu hat die Bayerische Staatssammlung in München Geweihproben der ältesten bekannten Hirsche zur Verfügung gestellt. Diese Tiere besaßen nur sehr kleine Geweihe. Dafür trugen die Männchen lange Eckzähne, wie wir es heute vom Moschustier oder dem Wasserreh kennen. Die mikroskopische Untersuchung soll nun zeigen, wie der Wechsel von Kommentkämpfen mit Eckzähnen zum Kampf mit dem Stirngeweih abgelaufen sein könnte. Aber auch bei anderen fossilen Wirbeltieren gibt es Hinweise auf ähnliche Zweikämpfe der Männchen. "Bei den paarigen Geweihen der Hirsche gibt es ein stabiles Gegenlager, wenn sich zwei kämpfende Tiere ineinander verkeilen, anders ist die Sache bei einigen Dinosauriern oder den ebenfalls ausgestorbenen Titanosuchiern, nashorngroßen Echsen, die nur ein Horn auf der Stirn hatten oder sogar nur einen verdickten, kuppelförmigen Stirnknochen besaßen. Wenn ein Tier gegen ein anderes rannte, wäre der Kopf zur Seite gedrängt worden ", sagt Pfretzschner, der schon darüber nachdenkt, wie die bis zu zehn Zentimeter dicke Schädeldecke solcher Echsen für die Kämpfe wohl konstruiert sein musste.
Für die Untersuchung der Mikrostrukturen von fossilen Knochen werden Dünnschliffe angefertigt und unter dem Mikroskop betrachtet. Dabei sehen die Wissenschaftler Knochenzellen und Kanälchen, die früheren Blutgefäße sowie Spuren des Knochenumbaues. "Nur in wenigen fossilen Knochen ist gar keine Struktur zu erkennen", meint der Paläontologe. Forscher hätten vor allem in den letzten fünfzehn Jahren gelernt, dass die Knochenmikrostruktur in erster Linie etwas über das Wachstum der Tiere aussagt sowie über spezielle Anpassungen. Wenn ein Tier ohne Pausen wächst wie zum Beispiel die heutigen Huftiere, dann sind die Knochen aus regelmäßigen Lagen aufgebaut. Wachstumspausen sind dagegen als so genannte lines of arrested growth (LAG) zu erkennen.
Bei den Dinosaurierknochen, die Pfretzschner von Grabungen im Jungga-Becken in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas mitgebracht hat, waren sechs bis acht solcher LAGs zu erkennen. Das war erstaunlich, da der Knochen dieser Tiere aus dem Jura vor rund 160 Millionen Jahren ein typischer schnellwachsender Knochen ist, wie er heute zum Beispiel bei Pferden auftritt. "Solche ausgeprägten LAGs in schnell wachsendem Knochen kannte man bisher nur von Raub-Sauriern aus dem Südpolargebiet", so der Forscher, "dort kann man sich vorstellen, dass es im Polarwinter über mehrere Wochen durchgehend dunkel war, Nahrung und Wasser knapp waren, sodass die Tiere in eine Art Winterruhe gingen." Doch die Dinos aus China haben bei 40 Grad nördlicher Breite gelebt , wo zwar weniger unwirtliche klimatische Bedingungen herrschten, die jedoch einem starken jährlichen Wechsel unterlagen. So geht man von einem Megamonsunklima aus, dessen kühle und sehr trockene Winter zu einem Wasserstress für Pflanzen und Tiere führten. "Das zeigen uns die Jahresringe im Querschnitt der fossilen Bäume, die wir als großen Glücksfall zusammen mit den Saurierknochen im Jungga-Becken gefunden haben", erklärt Pfretzschner. Die Ergebnisse sollen mit Hilfe geochemischer Methoden an Dinosaurierknochen bestätigt werden.
An der Saurier-Fundstelle im Nordwesten Chinas kann Pfretzschners Forschergruppe auch studieren, wie die Fossilisation von Knochen abläuft. Knochen bestehen zu einem großen Teil aus Calciumphosphat, enthalten aber bis zur Hälfte des Volumens Kollagen. Dieses muss bei der Fossilisation durch Calciumphosphat ersetzt werden. Im Sediment von Gewässern angereichertes Phosphat kann durch die Reduktionswirkung der Wirbeltierleiche mobilisiert werden und in den Knochen gelangen. Hinter der Erforschung der Prozesse bei der Fossilienbildung steht auch ein praktisches Interesse: "Wenn wir die Bedingungen umreißen können, unter denen Fossilien gebildet werden, wissen wir auch, wo wir danach suchen müssen", so Pfretzschner. Im chinesischen Dinosaurier-Fundgebiet stellte sich zum Beispiel heraus, das in einer bestimmten Bodenschicht zahlreiche Fossilfunde in einer 50 Meter breiten Ellipse angeordnet waren.
Zur Erforschung der Lebensbedingungen von ausgestorbenen Dinosauriern bleibt dem Wissenschaftler nur der mühsame Weg über die Knochen. Denn dass die Dinosaurier aus bis heute erhaltenem Erbgut wie im Film "Jurassic Park" wieder ins Leben gerufen werden könnten, hält der Tübinger Forscher für unwahrscheinlich. "Die Knochenmineralien stabilisieren zwar das Erbgut. Im Knochen reichert sich aber natürlicherweise auch radioaktives Uran an. Dessen Strahlung zerstört die DNA in wenigen Millionen Jahren weitgehend", erläutert Pfretzschner.
Quelle: Uni Tübingen (idw)